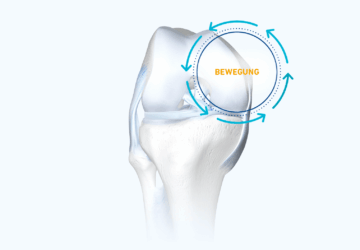Kurz & knapp „Patienten mit nicht-spezifischem Rückenschmerz müssen wir sehr früh aktiv in die Therapie einbeziehen und Risikofaktoren für einen chronischen Schmerzverlauf möglichst schnell erkennen “, sagt Priv.-Doz. Dr. med. Thilo Hotfiel. Eine ausführliche Anamnese und die körperliche Untersuchung sind die Basis für den individuell ausgerichteten Behandlungsweg. Für einen Rückgang der Beschwerden müssen die Patienten körperlich und muskulär aktiviert werden. Als unterstützende Maßnahme verordnet der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie dabei auch Lumbalbandagen wie die LumboTrain: „Aber nie als alleiniges Verfahren, sondern in einem multimodalen Ansatz.“
Bandagen·Orthesen·Rückenschmerzen
„Die Erstkonsultation ist entscheidend“
Nicht-spezifischer Rückenschmerz: Diagnose und Therapie
Von Bauerfeind Life am 22.08.2025

Der nicht-spezifische Kreuzschmerz birgt ein hohes Chronifizierungsrisiko, sofern dieser nicht frühzeitig behandelt wird, sagt Priv.-Doz. Dr. med. Thilo Hotfiel. Daher legt der Orthopäde aus dem westfälischen Kirchlengern großen Wert auf die Erstkonsultation und erklärt: „Allgemeinmediziner und Fachärzte haben auf dem Behandlungsweg eine Lotsenfunktion.“ Wichtige Meilensteine seien die strukturierte Untersuchung, Aufklärung und Beratung sowie die frühzeitige Aktivierung der Patienten.
Was genau ist unter nicht-spezifischem Rückenschmerz zu verstehen?
PD Dr. Hotfiel: Grundlegend wird diese Entität des Rückenschmerzes so genannt, wenn keine Hinweise auf spezifische Ursachen bestehen, wie zum Beispiel eine Nervenwurzelkompression infolge eines Bandscheibenvorfalls, eine entzündliche oder infektiöse Ursache, eine Fraktur oder auch schmerzhafte Veränderungen der Facettengelenke. Die Ursachen können sich äußerst heterogen darstellen und durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden. Bei jeder Form des Rückenschmerzes bestehen auf patho- beziehungsweise neurophysiologischer Ebene spezifische Ursachen und Auslöser, allerdings sind diese für die Erstbehandlung des nicht-spezifischen Rückenschmerzes zunächst von untergeordneter Therapierelevanz. Die Erstkonsultation ist entscheidend für die Weichenstellung der Therapie: Stehen spezifische Ursachen oder potenziell schwerwiegende Verläufe im Verdacht, müssen wir schnell reagieren und zum Beispiel eine Bildgebung oder Laboruntersuchung veranlassen.

Beim nicht-spezifischen Rückenschmerz hingegen müssen wir die Patienten sehr früh aktiv einbeziehen und Risikofaktoren für einen chronischen Schmerzverlauf möglichst schnell erkennen. Dazu beginnen wir mit einer ausführlichen Anamnese. Wir erfragen die Lokalisation, Art und Dauer der Beschwerden, auch ob es einen konkreten Auslöser gab, und wir erfragen grundlegende Informationen zu Allgemeinsymptomen, Vorerkrankungen und Medikamenteneinnahmen. Wir prüfen die Red Flags, das sind Warnzeichen für potenziell schwerwiegende Verläufe. Hierzu gehören Hinweise auf eine Beteiligung neuronaler Strukturen, entzündliche Prozesse oder mögliche Frakturen. Sind diese ausgeschlossen, prüfen wir Yellow Flags, das sind psychosoziale Warnzeichen für eine Chronifizierung. Allgemeine Unzufriedenheit, Abgeschlagenheit oder Depressionen können das Risiko erhöhen, genauso wie die Situation am Arbeitsplatz – sei es durch Stress, mangelnde Wertschätzung oder monotone Bewegungsabläufe und Fehlhaltungen. Eine sehr wichtige Frage in der Anamnese ist auch: Gibt es Faktoren, welche die Beschwerden lindern konnten?

Was gehört noch zur Erstkonsultation?
PD Dr. Hotfiel: Entscheidend ist neben der Anamnese die körperliche Untersuchung. Dabei inspizieren wir das Gangbild und die Körperstatik. Wir führen eine Palpation durch, machen Bewegungsüberprüfungen sowie Funktions- und Provokationstests. Die Wirbelsäule beziehungsweise der Rücken besteht aus vielen Strukturen und Bewegungssegmenten. Sie alle können im Einzelnen oder in ihrer Interaktion Auslöser der Beschwerden sein. Die sorgfältige Palpation liefert wertvolle Informationen. Häufig lassen sich globale oder lokale Veränderungen des Muskeltonus, wie muskel- oder sehnenbezogene Triggerpunkte, segmentbezogene schmerzhafte Irritationspunkte oder auch vegetative Begleitbefunde, zum Beispiel eine lokale Hyperämie, festhalten.
“Lumbalbandagen wie die LumboTrain geben Patienten Unterstützung und Sicherheit.”
Priv.-Doz. Dr. Thilo Hotfiel
Anschließend folgen dann strukturierte Bewegungsüberprüfungen sowie Funktions- und Provokationstests. Zumeist liegt eine komplexe multifaktorielle Genese vor und diese sollte in die Therapie miteinbezogen werden. Der nicht-spezifische Kreuzschmerz gehört mit zu den häufigsten Vorstellungsgründen in der hausärztlichen und orthopädischen Praxis. Es ist bekannt, dass etwa ein Drittel der Patienten innerhalb von drei Monaten genesen, aber zwei Drittel haben auch nach zwölf Wochen noch Beschwerden – hier liegt die Grenze zur Chronifizierung. Des Weiteren besteht eine hohe Rezidivrate. Die sozioökonomische Bedeutung ist also immens und es braucht die Implementierung von standardisierten und effizienten Abläufen für eine optimale Weichenstellung. Die NVL zum nicht-spezifischen Kreuzschmerz unterstützt hier mit wertvollen Hinweisen.

Wie sieht in der Regel der Weg eines Patienten mit diesem Beschwerdebild aus?
PD Dr. Hotfiel: Für viele Patienten ist der Hausarzt die erste Anlaufstelle, für andere der Facharzt. Das Wichtigste ist, dass der Mediziner schon zu Beginn eine Art Lotsen- oder Mentorenfunktion für den Behandlungsweg einnimmt, die Patienten informiert und begleitet. Ein Vertrauensverhältnis ist unabdingbar. Es geht darum, Schmerzen nicht zu bagatellisieren, aber auch nicht gleich zu viele diagnostische Verfahren einzuleiten. Beides kann Patienten verunsichern und den weiteren Therapieverlauf erschweren. Vielmehr sollten die Patienten von Anfang an in Therapieentscheidungen involviert und adäquat aufgeklärt werden. Es gilt, die individuellen Beschwerden zu erläutern und mit dem Patienten gemeinsam eine Art „Fahrplan“ für die möglichen Behandlungsmaßnahmen und die prognostizierten zeitlichen Verläufe zu erstellen. Des Weiteren muss auch in regelmäßigen Abständen re-evaluiert werden, ob die Therapie die Beschwerden ausreichend lindert oder gegebenenfalls die Diagnostik oder Therapie im Verlauf intensiviert werden muss.
Was gehört für Sie zu einer erfolgreichen Rückenschmerztherapie?
PD Dr. Hotfiel: Viele Aspekte sind entscheidend und letztlich hat jeder Patient individuelle Möglichkeiten und Ressourcen. Ein sehr wichtiger Aspekt ist die Selbstwirksamkeit, denn jeder Patient kann sehr viel Gutes für sich tun. Ein proaktives Verhalten und ein positiver Umgang auf körperlicher und psychosozialer Ebene sind entscheidend. Besonders bei multifaktoriellen Geschehen sind eine Funktionsverbesserung und ein Rückgang der Beschwerden oft nur durch eine körperliche und muskuläre Aktivierung möglich. Zyklische, ausdauernde Bewegungsformen und Übungen zur Kräftigung der Muskulatur und zum Erhalt der Mobilität und Beweglichkeit sollten dauerhaft in den Alltag eingebaut und Verhaltensweisen etabliert und manifestiert werden. Bewegung muss Spaß machen und zur Gewohnheit werden. Entscheidend ist nicht nur, was der Patient in zwei Wochen oder zwei Monaten macht, sondern auch in zwei oder 20 Jahren. Wir müssen jeden Patienten individuell betrachten, ein hohes Maß an Unterstützung leisten und die Prävention in ihrer Eigenverantwortung fördern.
Welche Rolle spielen Bandagen und Orthesen in Ihren Behandlungsplänen?
PD Dr. Hotfiel: Wenn orthopädische Hilfsmittel eingesetzt werden, sollten diese mit einer klaren Indikation und Zielsetzung verbunden sein. In der Behandlung des nicht-spezifischen Kreuzschmerzes setze ich unter anderem Lumbalbandagen als aktivierende und unterstützende Maßnahme ein. Aber nie als alleiniges Verfahren, sondern stets in einem multimodalen Ansatz, zum Beispiel mit einer Schmerztherapie, körperlicher Aktivität und Eigenübungen und gegebenenfalls Physiotherapie. Lumbalbandagen wie die LumboTrain geben Patienten Unterstützung und Sicherheit, erhöhen die Rumpfstabilität und. können dabei unterstützen, Vermeidungsverhalten und Ängste abzubauen und dabei die Aktivität und Bewegung zu fördern. Die zirkuläre Kompression hat vielfältige Effekte und beeinflusst auch die Thermoregulation, was viele Patienten als sehr angenehm empfinden. Nozizeptive und propriozeptive Effekte können zum Beispiel durch die integrierten Pelotten gefördert werden.

Wie bei allen Therapiemaßnahmen sollten Patienten auch Bandagen und Orthesen in ihrer Wirkung näher erläutert werden. Wenn Patienten den Grund ihrer Hilfsmittelversorgung nicht nachvollziehen können, sinkt die Compliance. Je besser sie mit den Hilfsmitteln vertraut sind, desto regelmäßiger tragen sie auch die Produkte und wenden sie richtig an. Einen Re-Check führe ich obligat bei der Verlaufskontrolle durch, in dem ich unter anderem die Passform und den Sitz des Hilfsmittels überprüfe und die Tragegewohnheiten erfrage.

In welchen Fällen setzen Sie eher stabilisierende und entlastende Orthesen ein?
PD Dr. Hotfiel: Die Auswahl sollte stets individuell erfolgen und an die Bedürfnisse sowie die funktionellen und strukturellen Voraussetzungen der Patienten angepasst werden. Stabilisierende und entlastende Orthesen können eingesetzt werden, wenn zu Anfang oder im Verlauf des Behandlungswegs konkrete Ursachen für die Beschwerden identifiziert werden, die orthopädietechnisch und biomechanisch beeinflusst werden können. Aufrichtende beziehungsweise reklinierende Orthesen sind zum Beispiel eine ideale Ergänzung, um bei einer Facettengelenksaffektion die hinteren Abschnitte der Wirbelsäule zu entlasten. Eine aufrichtende Orthese wie die LumboLoc Forte kann diese Strukturen durch ihre entlordosierende Wirkung gezielt entlasten und Schmerzen lindern. Der stabilisierende Effekt bestärkt Patienten nicht nur physisch, sondern auch mental, wieder aktiv etwas zu tun und sich zu bewegen.

Gibt es bei der Behandlung von Sportlern Besonderheiten zu beachten?
PD Dr. Hotfiel: Natürlich. Zunächst einmal sind Sportler genauso wie Nicht-Sportler von nicht-spezifischen Rückenschmerzen betroffen. Dennoch gibt es spezifische Verletzungs- und Überlastungsmuster, die in gewissen Sportarten oder bei Bewegungsmustern gehäuft auftreten können und einer gezielten Beachtung bedürfen. Wichtig ist, die Sportart und ihr Belastungsprofil zu kennen und das Trainingsverhalten des Sportlers zu erfragen. Wir müssen auch hier jeden Patienten und Sportler individuell betrachten, bei der klinischen Untersuchung sehr differenziert vorgehen und insbesondere strukturelle Überlastungsverletzungen ausschließen. Dann heißt es, unter Berücksichtigung der individuellen Ressourcen geeignete Maßnahmen einzuleiten und neben der Therapie viel Engagement und Einsatz in die Prävention zu stecken.
Bilder: Steffi Behrmann, Bauerfeind AG
Verwandte Themen
Hilfsmittel-App

Mit dieser App wird die Auswahl des geeigneten medizinischen Hilfsmittels für Ärzte und Fachhändler stark vereinfacht. Mit ihrer intuitiven Bedienbarkeit werden Informationen zu Bauerfeind-Produkten überall verfügbar – schnell und simpel